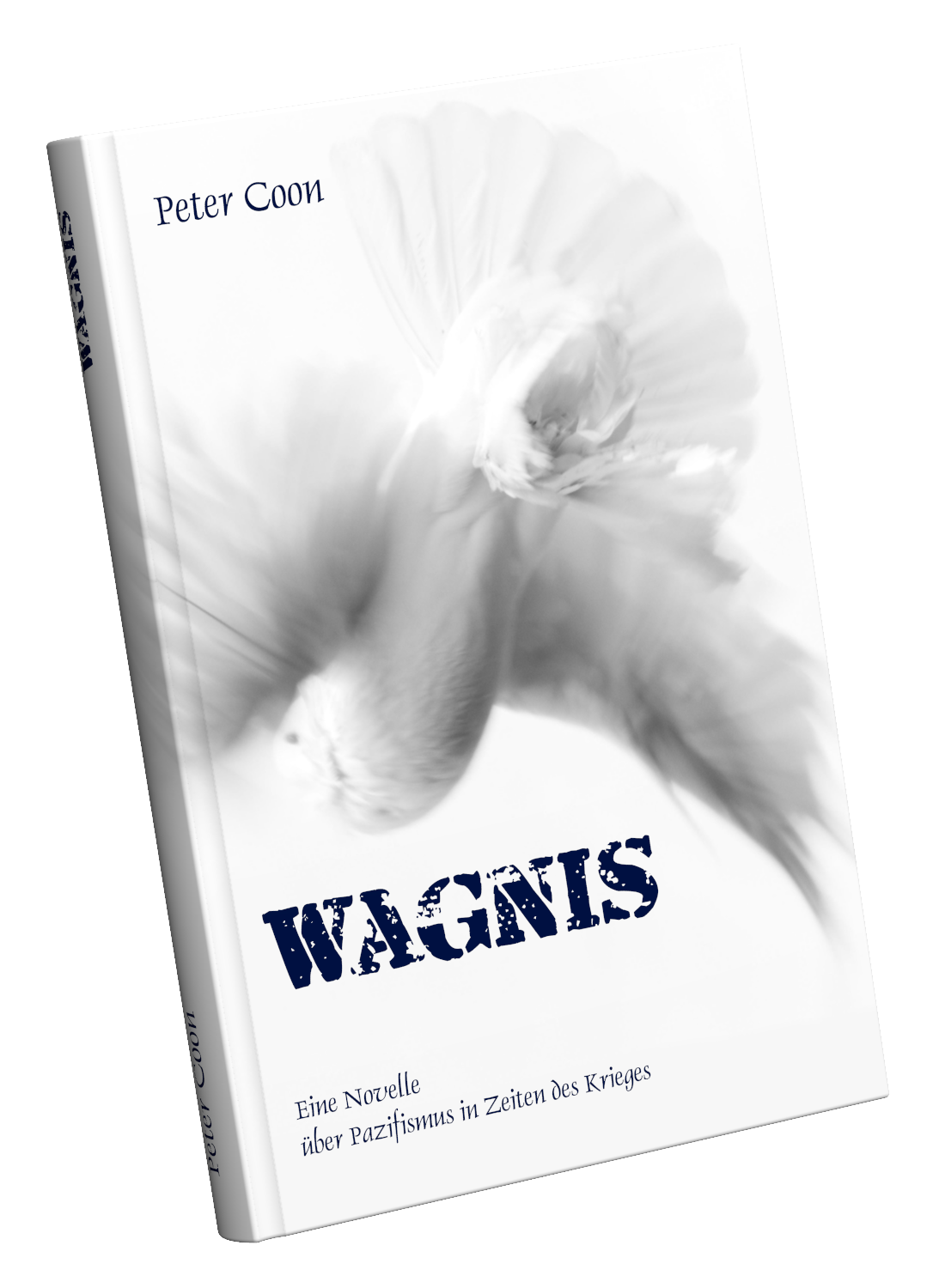Tor der Tränen
1. Platz beim Literaturpreis 2019 der Gruppe 48
Der Entscheider schaut auf die Uhr. Dann schreibt er etwas in Sayids Akte, die vor ihm auf dem Tisch liegt. Der Dolmetscher starrt auf das welke Ahornblatt, das Sayid am Stiel hin und her dreht.
»Sie sind also als blinder Passagier gereist. Die ganze Strecke, von Somalia bis Hamburg. Habe ich das richtig verstanden?«
Sayid nickt – und weiß genau, wie die nächste Frage lautet.
»Wie hieß das Schiff?«
Natürlich wollen sie den Namen wissen. Alles, was er hier sagt, wird irgendwie nachgeprüft, weiß Sayid. »Erfinde nichts hinzu«, hat man ihn in der Flüchtlingsberatung ermahnt. »Du darfst niemals in deinem Leben lügen«, hat sein Vater immer gesagt – und sein Vater ist ein weiser Mann, auf den er schon einmal nicht gehört hat. Aber was nun? Den Namen des Schiffes darf er auf keinen Fall nennen. Vor Wochen ging dieser Name hier durch die Presse. Ein Frachter unter deutscher Flagge und mit deutscher Besatzung, freigekauft aus der Geiselhaft. Somalische Piraten hatten es gekapert. Wochenlang lag es am Bab al-Mandab, der Meerenge zwischen der somalischen Küste und dem Roten Meer. Die Mannschaft wurde nicht gut behandelt, und so sitzt der deutsche Hass auf somalische Piraten tief. Wenn er jetzt den Namen dieses Schiffes nennt, werden sie ihre Schlüsse ziehen.
»Bitte legen Sie das Blatt zur Seite«, fordert ihn der Dolmetscher auf. Hellbraun ist dieses Blatt, ähnlich braun wie somalischer Wüstensand. Warum nur ist dieses Blatt so braun geworden, bei so viel Regen? Und warum ist es abgefallen von einem dieser buntgefärbten Bäume draußen im Stadtpark? Unglaublich, wie bunt die Blätter dieser Bäume sind. Vor wenigen Tagen noch waren sie alle grün, nicht mehr so saftig grün wie noch vor Wochen, aber immerhin grüner als alles, was Sayid jemals gesehen hat. Jetzt aber sind sie gelblich oder sogar rötlich, und spätestens sobald sie braun werden, lassen die Bäume sie fallen. Genau so, wie Sayid seine Untaten hat fallen lassen.
»Herbst«, sagt er. Er sagt dieses Wort auf deutsch, während er das Blatt noch immer zwischen Daumen und Zeigefinger hält.
»Herbst?«, fragt der Dolmetscher. »Nein, wie das Schiff heißt, wollten wir wissen.«
Sayid hält das Blatt etwas höher. »Herbst«, wiederholt er stolz. Dieses Wort hat er gestern im Sprachkurs gelernt – aus gegebenem Anlass. Es ist ein sehr schweres Wort, und er hat lange geübt daran. Nach dem Herbst kommt der Winter, das hat er auch gelernt, und dass es noch viel kälter wird im Winter. Das allerdings kann und will er nicht glauben.
»Ja, Herbst«, bestätigt der Dolmetscher und lächelt anerkennend. Auch der Entscheider lächelt, aber nur ganz kurz, und so verschwindet auch das Lächeln des Dolmetschers wieder.
»Bitte legen Sie es jetzt zur Seite. Sie sollten dem Entscheider Respekt zeigen.«
Sayid legt das spröde Blatt vor sich auf den Tisch und schaut den Entscheider freundlich an, so wie man es ihm in der Flüchtlingsberatung geraten hat, und obwohl er kein Wort versteht von dem, was sein Gegenüber jetzt zum Dolmetscher sagt.
»Gut«, sagt dieser dann zu Sayid. »Vielleicht fällt Ihnen der Name ja später noch ein. Jetzt schildern Sie bitte die Art Ihrer Verfolgung im Bürgerkrieg und die genauen Gründe, warum sie in Deutschland Asyl beantragt haben.«
Sayid schaut vor sich auf den Tisch. Ratlos ist er. Was soll er nur erzählen? Was hat er überhaupt zu erzählen? Von den Gefahren in seinem Heimatland soll er sprechen, von der Bedrohung durch den Bürgerkrieg, der viel älter ist als er selbst und dessen Sinn er nicht im Ansatz versteht. Er weiß, er muss reden von den islamistischen Terrorkommandos, von denen er aber nie eines mit eigenen Augen gesehen hat. Besser nicht reden sollte er dagegen – auch das hat man ihm geraten – von seinem Hunger und der Unterernährung seiner kleinen Nichten und Neffen, denn dann wäre er nur ein Wirtschaftsflüchtling und würde sofort abgelehnt. Er muss reden von den Gefahren, nach Kenia zu fliehen, wo Flüchtlinge verachtet, Frauen vergewaltigt und die Kinder zwangsrekrutiert werden. Doch all das hat er nicht selbst erlebt, nur Gerüchte gehört. Wie sollte er jetzt davon reden? Die Dürre dagegen, die er am eigenen Leib erlitten hat, die seiner Familie jede Chance nahm, als Bauern zu leben oder als Viehzüchter, wenn schon nicht mehr als Fischer wie bisher, die jahrelange Trockenheit muss er unerwähnt lassen, denn sonst wäre er sogar nur ein Klimaflüchtling, für dessen Anerkennung es überhaupt keine Rechtsgrundlage gibt. Reden sollte er von den tödlichen Kämpfen der Clans, von denen er überhaupt nichts versteht, von Attentaten und Überfällen, die er nie miterlebt hat, und der immerwährenden Angst, wie aus dem Nichts von Kugeln durchsiebt oder von einer Miene zerfetzt zu werden. Sayid hatte diese Angst nie. Wovon sollte er also reden?
»Bitte«, ermuntert ihn der Dolmetscher. »Erzählen Sie einfach die wichtigsten Ereignisse, die Sie erlebt haben.«
Nein, das darf er nicht, davon hat man ihm dringend abgeraten. Die wichtigsten Ereignisse seines Lebens muss er für sich behalten! Auf gar keinen Fall darf er die Kranken in den Fischerdörfern erwähnen und die missgebildeten Neugeborenen. Er hat sie fast überall gesehen entlang der somalischen Küste, vor der die Europäer illegal ihren Atommüll verklappt haben und sonstige Gifte, die nie jemand näher bestimmt hat. Er hat sogar die Fässer gesehen, die am Strand liegen und nach und nach durchrosten und vor denen alle Menschen dort Angst haben. Er kennt alle Berichte über die italienische Journalistin, die all das aufgedeckt hat, bevor sie ermordet wurde. Aber hier, vor diesen Europäern, darf er nicht darüber sprechen, schon gar nicht schimpfen, denn damit würde er genau die Menschen beschämen und beleidigen, die über seine Zukunft zu bestimmen haben. Genau so verhält es sich natürlich mit den riesigen Fischtrawlern aus der ganzen Welt, die nachts wie die Skyline von Manhattan über das Meer leuchten. Mit gigantischen Netzen fischen sie die somalische Küste leer, illegal. Eine somalische Küstenwache gab es nie, und europäische Behörden kümmern sich nicht darum. Doch darüber hier zu sprechen – auch das würde die Europäer beschämen und sich gar nicht gut auf seinen Asylantrag auswirken.
»Sie müssen jetzt etwas sagen«, drängt ihn der Dolmetscher. »Auch wenn es Ihnen schwerfällt.«
»Herbst«, sagt Sayid wieder. Vorsichtig legt er das Blatt auf seine offene Handfläche, die fast so weiß ist, wie das Gesicht des Entscheiders, der jetzt langsam ungeduldig wird.
»Erzählen Sie Ihre Geschichte«, mahnt der Dolmetscher.
»Der Herbst ist wie das Tor der Tränen«, sagt Sayid, diesmal nicht auf deutsch.
»Wie bitte?«
»Der Baum muss seine teuren Blätter fallen lassen, um den Winter zu überstehen.«
»Sie müssen jetzt Ihre Erlebnisse erzählen.«
»Er muss alles loslassen, um im Frühling wieder grün zu werden.«
»Stopp!«, sagt der Dolmetscher. »Der Entscheider kann Ihren Antrag nur positiv entscheiden, wenn Sie jetzt ...«
»Ich bin Pirat!«, bricht es aus Sayid heraus. Wütend springt er auf. Der Dolmetscher weicht zurück. Der Entscheider lässt seinen Stift fallen.
»Ich bin Pirat!«, wiederholt Sayid. »Mein Vater hat all seinen Söhnen verboten, zu den Piraten zu gehen. Piraten haben keine Seele mehr, hat er gesagt. Sie tun Unrecht und gehen daran zugrunde, hat er gesagt. Ich habe seine Worte ignoriert. Ich wollte einfach kämpfen. Ich wollte zur somalischen Küstenwache gehören und meine Familie retten.«
»Setzen Sie sich wieder«, sagt der Dolmetscher streng. »Und beruhigen Sie sich.« Doch Sayid lässt sich nicht aufhalten.
»Von Fischerbooten aus haben wir diesen deutschen Frachter gekapert. Sechs Wochen lang war ich dann auf dem Schiff. Wir hielten es am Bab al-Mandab fest. Ich bewachte die gefangenen Seeleute. Ich sah sie leiden, jeden Tag. Einen sah ich sterben. Ich habe geheult und wollte nur noch weg, zurück zu meinem Vater, ihn um Vergebung bitten, aber unsere Chefs ließen mich nicht gehen. Stattdessen nannten sie mich einen Verräter und verlangten viele böse Taten von mir, die mich noch heute in meinen Träumen verfolgen. Das ist meine Strafe dafür, dass ich mich mit Teufeln eingelassen habe. Mein Vater hatte recht: Heute ist meine Seele so verdorrt wie dieses Blatt.«
Sayid ballt seine Hand zur Faust und zerquetscht darin das spröde Blatt. Die Blattreste lässt er auf den Tisch rieseln.
»Ich verstehe Sie nicht«, sagt der Dolmetscher und schüttelt den Kopf. Doch Sayid hört ihm nicht zu.
»Wissen Sie«, fragt er, »was das Allerschlimmste für mich ist? Dass ich hier von Europäern Hilfe erbetteln muss.«
Der Dolmetscher beginnt mit den Händen zu fuchteln. »Hallo! Ich verstehe Sie nicht!«, wiederholt er.
»Europäer waren es, die unsere Küsten vergiftet haben. Keiner von ihnen ist dafür verurteilt worden. Europäer sind es auch, die unsere Küsten plündern, gemeinsam mit all den anderen reichen Nationen, die sich diese riesigen, schwimmenden Fischfabriken leisten können. Sie lassen sich beschützen von den Kriegsschiffen, auch deutschen, die am Bab al-Mandab stationiert sind und gegen uns Piraten kämpfen. Ja, sie nennen uns Piraten. Aber wir waren einst Fischer, denen Europa Krankheit und Hunger gebracht hat. Wer hat mit dem Unrecht angefangen? Wer sind die eigentlichen Piraten vor der somalischen Küste?«
Sayid betrachtet die beiden Männer vor sich. Europäer, denkt er. Keine Piraten, aber immerhin Leute, die zu Hause ihren Thunfisch essen und die es nicht interessiert, ob er vielleicht aus demselben Meer gestohlen wurde, in dem schon ihr Giftmüll versenkt worden ist.
»Und jetzt«, sagt Sayid und lässt sich auf seinen Stuhl fallen. »Jetzt sitze ich hier vor Ihnen. Ich muss Sie anlächeln und aufpassen, dass ich niemanden beschäme oder beleidige. Und ich muss genau überlegen, was ich erzähle und was nicht, weil es für Sie offensichtlich entscheidend ist, wodurch die Menschen sterben, die zu Ihnen kommen.«
Sayid lehnt sich zurück. Erschöpft lässt er den Kopf hängen und wartet ab, was nun geschieht.
»Ich habe kein Wort verstanden von dem, was Sie gesagt haben«, hört er die Stimme des Dolmetschers. »Sie scheinen wirklich schlimme Dinge erlebt zu haben, aber ich habe nichts davon verstanden.«
»Entschuldigen Sie«, sagt Sayid. »Ich hatte mich nicht unter Kontrolle.«
»Was war das für eine Sprache?«, fragt der Dolmetscher.
»Das war Oromo, die Sprache meiner Mutter.«
»Die Sprache Ihrer Mutter? Ist sie keine Somali?«
»Mein Vater ist Somali. Meine Mutter stammt aus Äthiopien. Sie ist damals nach Somalia geflohen. Als meine Eltern geheiratet haben, wurden beide aus ihren Clans verstoßen. Aber sie waren stark, und zwei Brüder meines Vaters haben zu ihnen gehalten. Meine Mutter sagt, seit dieser Zeit spricht mein Vater oft vom Bab al-Mandab.«
»Bab al-Mandab?«, fragt der Dolmetscher. »Ist das nicht diese Meerenge zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Aden, an dem auch Somalia liegt? Was meint Ihr Vater damit?«
»Bab al-Mandab heißt ‚Tor der Tränen‘. Für ihn ist es ein Symbol für einen schweren Weg, den man gehen muss, um das bessere Leben dahinter zu erreichen. In Europa würde man es vielleicht einfach – Herbst nennen.«
Der Dolmetscher sieht Sayid an. Dann redet er mit dem Entscheider.
»Sehen Sie«, sagt er schließlich. »Jetzt haben wir schon einiges über Ihre Familie erfahren. Nun können Sie uns sicher auch Ihre eigene Geschichte erzählen. Habe ich recht?«
Sayid schaut den Dolmetscher an, dann den Entscheider. Er versucht zu lächeln. Der Entscheider greift zu seinem Stift und beugt sich wieder über die Akte.
»Aber ich verstehe kein Oromo«, ergänzt der Dolmetscher noch. »Bitte bleiben Sie bei der somalischen Amtssprache.«
| (c) www.petercoon.de |
Diese Kurzgeschichte gewann 2019 den ersten Preis für Prosa beim Literaturwettbewerb der Gruppe 48.
Inzwischen wurde Tor der Tränen auch in meinem Buch Mama hält mich fest, wenn ich lache veröffentlicht.
Schreibe hier den ersten Kommentar:
Abgedrängt, umgelenkt, gebrochen
1. Platz beim Literaturwettbewerb des Autorenkreises Ruhr-Mark 2013
Karl erschien mir immer als blau. Wir kannten uns schon seit unserer gemeinsamen Kindergartenzeit und waren dicke Freunde, auch später auf der Grundschule und dem Gymnasium. Fast jeden Nachmittag trafen wir uns, und während all dieser Zeit kam er mir irgendwie blau vor. Ich meine damit nicht seinen Alkoholspiegel, obwohl dieser zuletzt immer öfter auch diese Art von Blau-Sein verursachte. Nein, ich meine wirklich die Farbe Blau.
Nach drei Kurzgeschichtenbänden und einer viel zu langen Pandemiezeit erscheint mit Wagnis nun endlich wieder ein Buch von Peter Coon – diesmal eine einzelne Geschichte, eine Novelle über Pazifismus in Zeiten des Krieges.